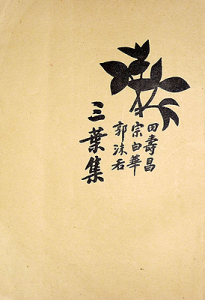Laojiu 老酒, japanisch Raochū, ist eine lang gereifte Sorte von Huangjiu 黄酒 („Gelbwein“) aus Reis, Weizen oder Hirse mit weniger als 20% Alkoholgehalt.
Erster Teil der Übersetzung: Die Leute aus Shanghai. Guo Moruo in der japanischen Presse
♦
Herr Maeda, der Verwalter des men’s house, in dem ich untergekommen bin, ist ein bekannter Mann in Shanghai; er ist Christ, Unternehmer und ein ziemlich guter Gesprächspartner. In diesem house haben schon Herr Kagawa Toyohiko,1 der Agrarwissenschaftler Herr Dr. Yamazaki Momoji2 und andere übernachtet. Was diesen Kagawa Toyohiko angeht: Er hat von der neuen Shanghaier Gruppe Verachtung erfahren. Ihm leisten nur noch hohe Beamte, reicher Männer Ehefrauen, alte Christen und Spione Gesellschaft. Dr. Yamazaki jedoch promovierte ursprünglich als Lehrer der Dōbun-Shoin-Universität, indem er Laojiu-Wein erforschte und ist eine neue Autorität in Bereich japanischer Bakterien-Fermentierung. (Heute lehrt er an der Gifu Hochschule für Land- und Forstwirtschaft.) Auf der ganzen Welt gibt es niemanden, der Laojiu-Wein so gründlich kennt wie er; er kennt ihn sogar so gut, daß er auch für’s Trinken einen Doktor bekommen sollte. Er ist ein äußerst offenherziger Weltbürger und genau der Typ Mensch, der in Shanghai wohnt. Ich habe von ihm viel über Laojiu-Wein erfahren.