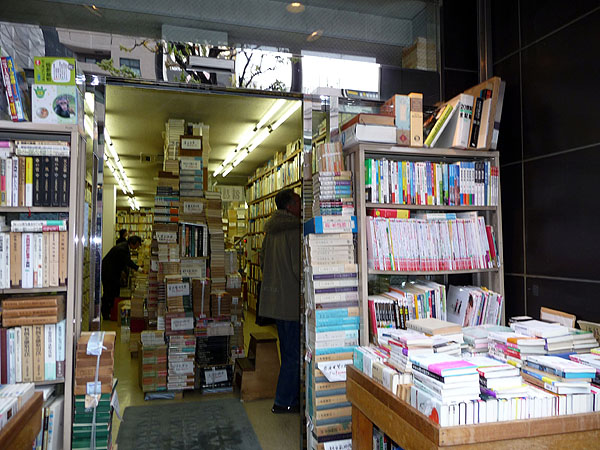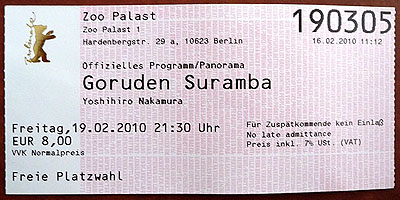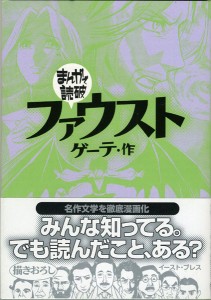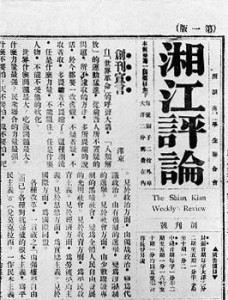GUŌ Mòruò wurde 1892 unter dem Namen Guō Kāizhēn (郭开贞) in einer wohlhabenden Familie in Sichuan geboren. Schon früh begann er, sich für Pantheismus zu interessieren, namentlich für die Ideen des Philosophen Zhuangzi. Nach einer traditionellen, jedoch von Umbrüchen geprägten Ausbildung wurde er mit einer ihm bis dato Unbekannten durch seine Familie in einer arrangierten Hochzeit (包办婚姻 baōbàn hūnyīn) verheiratet. Enttäuscht von seiner Familie, aber auch vor allem von sich selbst, weil er sich wider besseren Wissens auf eine arrangierte Ehe eingelassen hatte, reiste Guō schon wenige Tage später ab und gelangte über verschiedene Zwischenschritte schließlich 1913 nach Japan, wo er ein Medizinstudium begann. Dort lernte er im Sommer 1916 die Japanerin SATŌ Tomiko (佐藤富子), genannt Anna, kennen, die selbst vor einer arrangierten Ehe nach Tokyo geflüchtet war. Sie hatten in den 20 Jahren, die sie zusammen waren, fünf Kinder; die Ehe wurde jedoch von beiden Familien nie akzeptiert.
In Japan war er mit dem naturwissenschaftlichen Teil seines Studiums unglücklich, lernte aber Deutsch, Englisch und Latein und hatte im Deutschunterricht die ersten Kontakte mit Goethe, insbesondere mit „Dichtung und Wahrheit“. Etwa 1918 hat er Werther gelesen und daran gedacht, den Roman zu übersetzen. Im Sommer 1919 begann er die ersten Faust-Übersetzungen, die er bei seinen Besuchen in Shanghai anfertigte. In dieser Zeit schrieb er auch das erste Mal ernsthaft an eigenen Werken und begann, mit seinen Übersetzungen seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Sein in freien Versen geschriebener Gedichtband Göttinnen (女神 nüshén), veröffentlicht 1921, gilt als der Durchbruch einer neuen Lyrik in China.